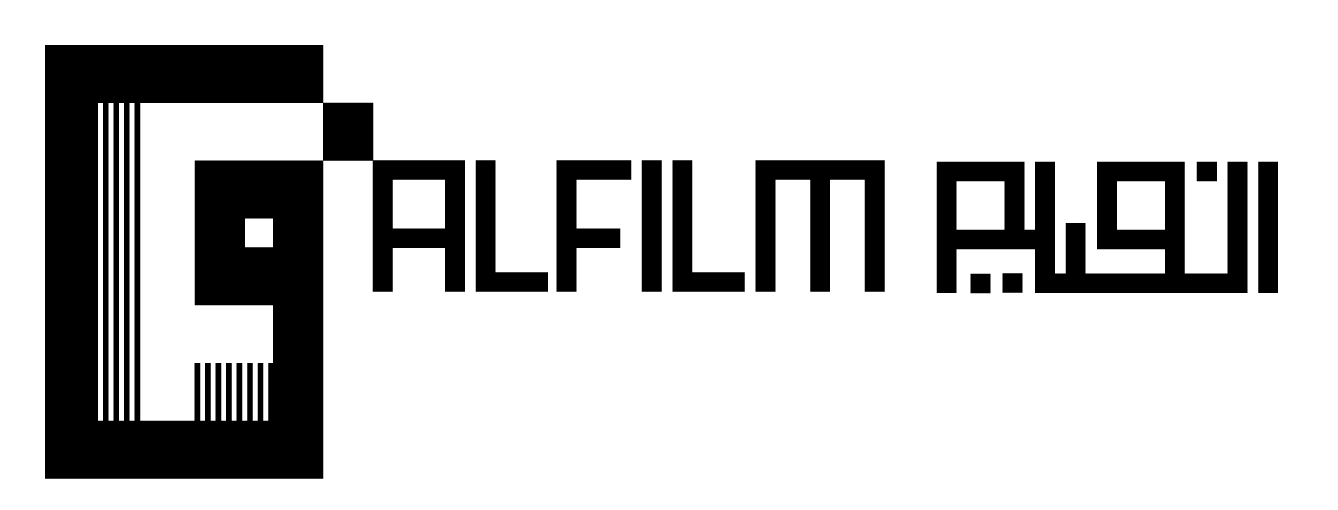Das vollständige Programm der 17. Ausgabe wird Anfang April veröffentlicht! Freut euch auf eine spannende Auswahl an aktuellen Spielfilmen, Dokumentarfilmen und Kurzfilmreihen, die durch inspirierende Gespräche mit Filmemacher:innen bereichert werden. Zusätzlich erwarten euch spannende Panels und exklusive Masterclasses.
Bleibt auf dem Laufenden: Folgt uns auf Instagram und meldet euch für unseren Newsletter an, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Wir können es kaum erwarten, bald mehr mit euch zu teilen!